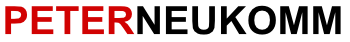Das gescheiterte Erneuerungsprojekt der KBA Hard hat den Kläranlageverband (KAV) in den vergangenen zwei Jahren finanziell wie organisatorisch erheblich gefordert. Die Verwaltungskommission (VK) des KAV und die neue Betriebsleitung haben nun mit grossem Engagement die Weichen gestellt, um die technologischen und finanziellen Herausforderungen künftig erfolgreich bewältigen zu können. Unterdessen liegen die Planungskredite im Hinblick auf eine mögliche Sanierung den Parlamenten und Gemeinderäten der vier Verbandsgemeinden zur Bewilligung vor. Diese Kredite beinhalten u.a. die Kosten für umfangreiche Tests mit der Biogasanlage, welche Aufschluss über deren Leistungsfähigkeit und Sanierbarkeit sowie die erforderlichen Investitionskosten geben sollen. Verlaufen die Tests in diesem Sommer erfolgreich und ergeben die Wirtschaftlichkeitsberechnungen positive Resultate, wird im Herbst/Winter mit einer Sanierungskreditvorlage zu rechnen sein. Damit der KAV nach einer Sanierung der KBA Hard wieder auf Kurs kommen kann, ist er unter anderem auch darauf angewiesen, dass ihm künftig eine ausreichende Menge Siedlungsabfälle zur Verfügung steht.
Während die Gemeinden Feuerthalen und Flurlingen aufgrund einer Zuweisung durch den Kanton Zürich ihren Siedlungsabfall dem KAV abliefern müssen, sind die Schaffhauser Gemeinden frei. So hat die Stadt Stein am Rhein den Vertrag mit dem KAV per Ende 2015 gekündigt und wird ihren Abfall künftig an die KVA Thurgau liefern. Es ist ein offenes Geheimnis, dass weitere Vertragsgemeinden des KAV von privaten Entsorgungsunternehmen umworben werden. Bereits in der kantonalen Abfallplanung vom Mai 2008 wurde die langfristige Sicherung der Auslastung der KBA Hard durch Gewährleistung der eingeplanten Mengen als dringendster Handlungsbedarf im Bereich „Kehricht/Sperrgut“ identifiziert. Aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben (USG, TVA) ist davon auszugehen ist, dass der Kanton nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet ist, für Siedlungsabfälle Einzugsgebiete festzulegen und für den wirtschaftlichen Betrieb der Abfallanlagen zu sorgen. Aufgrund dieser Ausgangslage ist dem Regierungsrat folgender Prüfungsauftrag zu erteilen:
Der Regierungsrat wird beauftragt, im Rahmen der periodisch durchzuführenden Abfallplanung die Einführung einer Zuweisungspflicht für Siedlungsabfälle zu prüfen.
Heute besitzen die reichsten 2 % der Bevölkerung gleich viel Vermögen wie die restlichen 98 %. Das hat auch damit zu tun, dass schweizweit rund 67 Milliarden pro Jahr mehrheitlich steuerfrei vererbt werden. Zudem wurde die Bildung riesiger Vermögen in den vergangenen Jahrzehnten steuerlich massiv begünstigt: Kapitalsteuer, Emissionsabgabe, Umsatzabgabe, Versicherungsstempel wurden abgeschafft. Die Dividendenbesteuerung wurde halbiert und die Unternehmenssteuerreform II erlaubt Grossaktionären jährlich Milliarden steuerfreie Einkommen. Allein das Dividendensteuerprivileg hat zu grossen Löchern bei der öffentlichen Hand geführt, aber auch zu mehreren hundert Millionen Ausfällen bei der AHV. Wie werden diese Löcher nun gestopft? Zum Ausgleich müssen Mehrwertsteuer erhöht, die Lohnnebenkosten hinaufgeschraubt und mehr Gebühren erhoben werden. Auch die Erhöhung des AHV-Alters steht zur Diskussion. Das alles trifft vor allem den Mittelstand und die unteren Einkommensschichten. In dieser Situation macht eine moderate Erbschaftssteuer auf extrem hohe Nachlässe ab 2 Millionen resp. bei Ehepaaren ab 4 Millionen Sinn. Sie würde bei der AHV zu Mehreinnahmen von 4 Milliarden pro Jahr führen und damit einen gerechten Beitrag zur Entlastung der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung leisten. Entgegen der Propaganda der Initiativegegner werden Arbeitsplätze von KMUs durch die Erbschaftssteuerinitiative nicht gefährdet, weil das Bundesparlament für solche Fälle einen hohen Freibetrag und einen reduzierten Steuersatz festlegen kann.
Mit einer Kleinen Anfrage vom 06.09.2010 (2010/19) ersuchte Kantonsrat Matthias Freivogel – in Anlehnung an den Wirksamkeitsbericht des Bundesrats vom 31.03.2010 – den Regierungsrat darum, die Wirksamkeit des Finanzausgleichs von Kanton und Gemeinden zu überprüfen.
Der Regierungsrat hat mit Antwort vom 29.03.2011 in Aussicht gestellt, frühestens per Ende 2011 einen Wirksamkeitsbericht zum neuen Finanzausgleich Kanton – Gemeinden zu erstellen. Die Antwort auf Frage 2 der Kleinen Anfrage lautete wie folgt:
„Wie bereits in den Schwerpunkten der Regierungstätigkeit 2011 angekündigt, will der Regierungsrat einen Bericht erarbeiten über die Auswirkungen der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen im Kanton Schaffhausen und über die Finanzierungsentflechtungen zwischen Kanton und Gemeinden im Rahmen der Einführung der NFA. Im Bericht soll aufgrund der Erfahrungen in den ersten drei Rechnungsjahren (2008 – 2010) insbesondere geprüft werden, wie sich die Finanzierungsentflechtungen zwischen Kanton und Gemeinden ausgewirkt haben.
Bevor ein solcher Bericht erstellt worden ist, wurden nun umfangreiche Projekte des NFA Kanton – Gemeinden über die Entlastungsmassnahmen 2014 (EP14) wieder aufgeschnürt (z.B. Kostenteiler in der Alterspolitik). Deshalb stellen sich folgende Fragen:
- Warum wurde der versprochene Wirksamkeitsbericht nie erstellt resp. publiziert?
- Wie sollen die Gemeinden ohne einen solchen Bericht die vorgeschlagenen Entlastungsmassnahmen von EP14, die in diese Finanzierungsentflechtungen eingreifen, fundiert beurteilen können?
- Wie soll im Rahmen der Strukturreform des Kantons eine sinnvolle Aufgabenteilung und Finanzierungsentflechtung erreicht werden, wenn zur bestehenden noch keine genügenden Grundlagen bestehen?
Über die Frage der Lockerung der obligatorischen Inventarpflicht in Erbschaftsfällen gingen die Meinungen im Kantonsrat auseinander, quer durch alle Fraktionen. Weshalb soll man den Erben etwas aufzwingen, wenn sie das gar nicht brauchen und wollen? Darüber könnte man ja noch diskutieren.
Mit der von einer Mehrheit des Kantonsrats beschlossenen neuen Gebührenregelung käme es zu einer spürbaren Entlastung der Erben von Millionennachlässen auf Kosten der Gemeinden und des Kantons und damit zu Lasten der Steuerzahlenden. Es ist unverständlich, wie man so etwas beschliessen kann, während dem man gleichzeitig den Staatshaushalt über 40 Millionen Franken entlasten muss und dies über einen schmerzhaften Leistungsabbau vollziehen will. Es ist absehbar, dass mit der neuen Regelung die Erbschaftsämter der Gemeinden zu unentgeltlichen Rechtsberatungsstellen mutieren. Die Erben werden aus Kostengründen auf ein amtliches Inventar verzichten und nachher bei Unklarheiten und Problemen trotzdem wieder Rat bei den Erbschaftsämtern einholen. Deshalb lehne ich die Revision des Einführungsgesetzes zum ZGB ab.
Die Lex Koller wird nicht abgeschafft, dies haben die eidgenössischen Räte letztes Jahr beschlossen. Damit dürfen Ausländerinnen und Ausländer ohne festen Wohnsitz in der Schweiz weiterhin keine Wohnimmobilien kaufen. Dies gilt auch für juristische Personen, die zwar ihren Sitz in der Schweiz haben, aber von Personen im Ausland beherrscht werden. Mit der Beibehaltung der Lex Koller rückt der Vollzug der Bestimmungen in den Vordergrund. Und um diesen ist es offenbar nicht überall zum Besten bestellt. So schilderte die NZZ am 28.05.2014 unter dem Titel „Behörden-Schlendrian im Villenquartier“, wie einfach die Lex Koller ausgehebelt werden kann resp. wie lasch die Kontrollen der zuständigen Kantone zum Teil sind. Der Vollzug ist gemäss Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland in erster Linie Sache der Kantone, in denen die Grundstücke liegen.
Ich bitte deshalb den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:
- Seit 2002 dürfen Personen aus der EU und den EFTA Staaten mit rechtmässigem Wohnsitz in der Schweiz trotz der Lex Koller Grundstücke erwerben. Nach welchen Grundsätzen erfolgt die Überprüfung des Wohnsitzes resp. Lebensmittelpunkts der Käuferinnen und Käufer? Nach welchen Kriterien trifft welche Instanz vertiefte Abklärungen? Welche Daten stehen ihr dabei zur Verfügung? Was geschieht, wenn Käuferinnen und Käufer nach einem rechtmässigen Erwerb ihre Schriften wieder ins Ausland transferieren?
- Wie viele Gesuche um Grunderwerb durch Ausländer wurden in den letzten fünf Jahren im Kanton Schaffhausen gestellt und wie viele Bewilligungen wurden in diesem Zeitraum erteilt resp. abgewiesen? Wie viele Verkäufe wurden in den letzten fünf Jahren durch die erste Beschwerdeinstanz kontrolliert?
- Wie wird bei juristischen Personen, welche Grundstücke im Kanton Schaffhausen erwerben wollen, überprüft, dass sie nicht ausländisch beherrscht sind? Welches sind die Kriterien der Überprüfung?
- Gemäss geltendem Recht dürfen Ausländerinnen und Ausländer Gewerbeimmobilien kaufen. Wie viele Gewerbeimmobilien wurden an Personen im Ausland verkauft (juristische und natürliche)?
- Wie viel Bauland in der Industrie- und Gewerbezone wurde an Personen im Ausland verkauft? Wie viele davon wurden unterdessen in Wohnzonen umgezont resp. zu Wohnzwecken umgenutzt? Wie wird sichergestellt, dass bei einer Umzonung resp. Umnutzung zu Wohnzwecken die Lex Koller nicht umgangen wird? Prüft der Kanton bei einer Umzonung erneut die Erfordernisse der Wohnsitz- und Steuerpflicht der Eigentümer?
- Welche Personalressourcen stehen im Kanton Schaffhausen für den Vollzug der Lex Koller zur Verfügung? Erachtet der Regierungsrat diese Zahl als genügend?