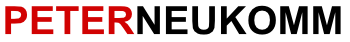Radio Munot Beitrag vom 24.03.2023
Votum im Kantonsrat zur Revision des Finanzhaushaltsgesetzes und der damit von der GPK beabsichtigten Einschränkung der finanzpolitischen Reserve
Ich spreche hier nicht nur als Vertreter der Stadt, sondern auch als Vertreter des Verbands der SH-Gemeindepräsidenten, der den Antrag der GPK als Zwängerei empfindet, um Kanton und Gemeinden bei der Bildung von finanzpolitischen Reserven unnötig einzuschränken. Damit wird völlig über das Ziel hinausgeschossen.
Mit dem Vorschlag der Regierung können die Gemeinden leben. Sie haben das in ihrer Vernehmlassung signalisiert.
Diese «Zwangsjacke» für die Gemeinden lässt sich weder finanzrechtlich – HRM2 lässt den bestehenden Spielraum zu und dieser wird in anderen Kantonen auch genutzt – noch politisch begründen.
Die Gemeinden haben das Instrument der finanzpolitischen Reserve bisher äusserst verantwortungsvoll eingesetzt und werden das auch in Zukunft tun.
Der Kanton als zuständige Gemeindeaufsicht bestätigt dies auf S. 3 der regierungsrätlichen Vorlage: «Die Gemeinden sind in den Vergangenen Jahren behutsam mit der Bildung von finanzpolitischen Reserven umgegangen (…).»
Also nichts von Fouls und unfairem Vorgehen, sondern alles demokratisch legitimierte Entscheide. Die Gemeinden wehren sich dezidiert dagegen, dass die finanzpolitischen Reserven missbräuchlich oder manipulativ verwendet worden sind. Die Töpfli sind in den Gemeinden auch nicht inflationär unhygienisch verwendet worden. Sie sehen das in der Aufzählung der Vorlage des RR.
Die SH-Gemeinden möchten auch künftig die Möglichkeit der «Vorfinanzierung» für geplante Vorhaben nutzen können und zwar bevor diese bereits rechtkräftig vom zuständigen Organ, in der Regel von der Gemeindeversammlung oder den Stimmberechtigten, verabschiedet worden sind.
Der Regierungsrat hat zurecht darauf hingewiesen, dass die Finanzierungsfrage seriöserweise vor dem rechtkräftigen Beschluss zu einem Vorhaben geklärt werden muss, genauso übrigens, wie das Unternehmen und Private machen.
Denn Grossprojekte brauchen oft einen längeren Planungszeitraum. Das gilt auch für deren Finanzierung.
Gerade weil es für die Gemeinden sonst Schwierigkeiten haben, grosse Investitionen zu stemmen, brauchen sie hier eine gewisse Flexibilität bei der «Vorfinanzierung».
Erst nach einem Entscheid der zuständigen Instanzen damit zu beginnen, ist weltfremd. Da fehlt die nötige Vorlaufzeit, um das sinnvoll zu gestalten.
Hier geht es also nicht um die Präjudizierung von demokratischen Entscheiden, sondern es geht um eine möglichst vorausschauende Politik, welche sich nicht erst nach der Bewilligung eines Grossprojekts um deren Finanzierung kümmert.
Wenn der Rat der Variante der GPK zustimmt, ist das an den Bedürfnissen der Gemeinden vorbei.
Diese werden sich deshalb in einer allfälligen Volksabstimmung vehement gegen eine solche Einschränkung ihrer Investitionsfähigkeit wehren.
Ich hoffe, dass das nicht nötig sein wird und der Rat Vernunft walten lässt, so wie die Gemeinden auch Vernunft bei der Bildung von finanzpolitischen Reserven walten lassen.
Die SH-Gemeinden sind dabei übrigens nicht weniger verantwortungsvoll als die Gemeinden anderer Kantone.
Wenn Sie heute den GPK-Anträgen zustimmen, müssen die Gemeinden dies als Misstrauensvotum verstehen.
Ich bitte Sie deshalb, votieren Sie für den vernünftigen Antrag der Regierung, damit auch die SH-Gemeinden bei der Vorfinanzierung von grossen Vorhaben weiterhin eine gewisse Flexibilität behalten oder wie es der Regierungsrat richtig formuliert hat: «es soll ihnen weiterhin ein grösserer Handlungsspielraum belassen werden, wie er sich unter geltendem Recht entwickelt hat.»
Votum im Kantonsrat vom 23.01.2023
Ich spreche hier nicht nur als Kommissionsmitglied, sondern auch als Vertreter der Stadt, für welche die polizeiliche Grundversorgung besonders wichtig ist und als ehemaliger Strafverfolger, der Situation bei der SHPol aus eigener Erfahrung kennt. «Es ist höchste Zeit». Unter diesem Motto müsste die heutige Vorlage stehen. Ich bin froh, dass die Kommission sich hier weitgehend einig war, wie Sie von meinen Vorrednern und der zuständigen Regierungsrätin gehört haben. Denn der Handlungsbedarf ist mehr als ausgewiesen: Der Personalbestand hat mit gesellschaftlicher Entwicklung, Bevölkerungs- und Verkehrswachstum mitgehalten. Dasselbe gilt aber auch für die erhöhten Anforderungen der gesetzlichen Grundlagen und der dazu gehörenden Rechtsprechung, auf denen das polizeiliche Handeln beruht. Das spüren vor allem die Gemeinden und im speziellen die Stadt als Hotspot des Kantons, wo sich vor allem am Wochenende alle ausgehfreudigen Leute aus der ganzen Region, nicht nur aus unserem Kanton, treffen und bis in die Morgenstunden feiern. In fast allen Städten und Kantonen wurden die polizeilichen Ressourcen in den vergangenen 20 Jahren den geänderten Anforderungen und Verhältnissen angepasst und die Korps aufgestockt – nur in Schaffhausen nicht. Die polizeiliche Grundversorgung ist deshalb nicht mehr genügend gewährleistet und zwar nicht nur im Zentrum des Kantons. Ich höre das auch von meinen Kolleginnen und Kollegen in den Gemeindepräsidien unseres Kantons. Die heutige Personalsituation führt dazu, dass sich Leute, die sich nicht an die Regeln halten, in Schaffhausen immer sicherer fühlen können. Und weil die Ressourcen der SHPol nicht reichen, beginnen die kommunalen Behörden damit, die Sicherheit zu privatisieren, indem sie private Sicherheitsdienste beauftragen, auch die Stadt. Das ist keine gute Entwicklung. Diese Aufstockung ist für mich dringend, auch mit eindrücklichen Zahlen gut begründet und moderat: Die zwei zusätzlichen 2-er Patrouillen für den ganzen Kanton müssen jetzt ermöglicht werden, denn wir wissen, dass das nicht von einem auf den anderen Tag möglich ist, sondern Jahre braucht, bis er erreicht ist. Der Ausbau im Bereich der Grundversorgung entlastet auch die anderen polizeilichen Bereiche, aus denen dauernd Kräfte abgezogen werden müssen und die deshalb ihre Arbeit auch nicht mehr in der nötigen Zeit erledigen können. Zusammen mit der aufgegleisten Reorganisation der Polizei soll damit die Überbelastung reduziert und auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. Das ist somit ein wichtiger Beitrag zur Attraktivierung des Polizeiberufs in SH. Heute geht es also nicht um die Anpassung des polizeilichen Auftrags, der auch nötig ist, um in einzelnen Bereichen auf neue Herausforderungen zu reagieren. Dies werden wir im Rahmen der Totalrevision des Polizeigesetzes einfordern. Diese aber jetzt gegen die künftige Gewährleistung des Grundversorgungsauftrags auszuspielen, wäre der falsche Weg. Ich hoffe, dass Sie den vernünftigen Anträgen von Kommission und Regierung folgen werden.
Kommissionsbericht zur Einführung eines Ratsinformationssystems anlässlich der Kantonsratsdebatte vom 11.04.2022
Als Kommissionspräsident ist es an mir, zuerst ganz herzlich zu danken:
Mein Dank geht an die Kommissionsmitglieder, die sich konstruktiv, engagiert und zielorientiert eingebracht haben.
Danken möchte ich aber auch Beat Kobler, Key Account Manager der KSD, der uns als Fachspezialist mit Rat und Tat zur Seite stand.
Die KSD war also in ihrer Rolle als Generalunternehmerin und Beraterin mit einbezogen. Für fachliche Fragen steht Beat Kobler auch heute zur Verfügung.
Wichtig waren auch die Inputs von Claudia Indermühle als Vertreterin des Ratssekretariats, weil ein Ratsinformationssystem ja auch die Arbeit des Sekretariats erleichtern soll.
Besten Dank an Claudia Intermühle für den gewohnt professionellen administrativen Support.
Inhaltlich haben wir die Gründe, welche für die Einführung eines solchen Systems sprechen, ja schon am 7. Dezember 2020 bei der Beratung meiner Motion, die Sie mit 44 : 13 ans Ratsbüro überwiesen haben, diskutiert. Deshalb halte ich mich da kurz.
Im Zentrum stand, die Chancen der Digitalisierung auch für die Legislative zu nutzen, ganz im Sinne der Zielsetzung der Regierung, dass unser Kanton bei der Digitalisierung eine Vorreiterrolle spielen soll.
Wichtig war in der damaligen Debatte wie auch bei den Beratungen in der Kommission, dass Digitalisierung und Technologien nie Selbstzweck, sondern immer Instrumente im Dienste der Menschen sein müssen. Das gilt auch für ein elektronisches Ratsinformationssystem. Es soll für den Kantonsrat, das Sekretariat und für die Öffentlichkeit einen Mehrwert generieren.
Unterdessen sind da viele Parlamente in unserem Land, nicht nur auf kommunaler, sondern auch auf kantonaler Ebene, viel weiter als wir.
Viele haben Standardsysteme im Einsatz, welche wertvolle Instrumenten bieten, um die Parlamentsarbeit zu vereinfachen, effizienter und ressourcenschonender zu machen.
Eine elektronische Geschäftsverwaltung umfasst u.a. die Aktenführung, die Ablaufsteuerung und die Termin- und Pendenzenkontrolle von Geschäften.
Jedes Mitglied hat jederzeit und von überall her Zugriff auf alle nötigen Dokumente und Geschäfte.
Kollaborationsplattformen vereinfachen die Erarbeitung von Kommissionsberichten, also die kommissionsinterne Kommunikation, aber auch die Kommunikation des Rats mit Verwaltung und Regierung. Effiziente Suchmöglichkeiten sind selbstverständlich.
Die 9-er SPK hat den Auftrag des Rates ernst genommen.
In der ersten von drei Sitzungen haben wir die zu erfüllenden Bedürfnisse und die sich daraus ergebenden Anforderungen an ein solches System geklärt.
Klar war für alle, dass – nach dem Debakel mit Peak – ein Standardsystem ausgewählt werden soll, das sich andernorts bereits bewährt hat und das einfach auf die Schaffhauser Verhältnisse angepasst werden kann.
Naheliegend war, das Geschäftsverwaltungssystem Axioma von CMI Informatik AG anzuschauen, weil das bereits beim Regierungsrat, der Staatskanzlei und bei den Departementssekretariaten im Einsatz steht.
Das Modul Sitzungsmanagement wird in vielen Stadt- und Kantonsparlamenten schon erfolgreich verwendet. In der Deutschschweiz ist CMI Axioma klar Marktführerin.
Um zu sehen, was ein solches Ratsinformationssystem für einen Mehrwert bieten kann, wurde CMI für die zweite Sitzung eingeladen, um das Tool vorzustellen.
Die Fragen der Kommissionsmitglieder und der Sekretariatsvertreterin wurden kompetent beantwortet. Es zeigte sich, dass das Tool einfach auf die Schaffhauser Verhältnisse parametrisiert werden könnte und seine stetige Weiterentwicklung gesichert ist. Neue Bedürfnisse und Anliegen der Nutzer werden dabei laufend implementiert.
Das Produkt erfüllt einen hohen Sicherheitsstandard.
Hier ergaben sich im Vorfeld der Beratung im Rat in meiner Fraktion noch Fragen, die ich aufgenommen und durch die KSD klären liess.
Sie haben letzte Woche deshalb die fachliche Einschätzung der KSD dazu schriftlich erhalten. Sie ergänzen die Erläuterungen zur Datensicherheit auf S. 5, Ziff. 8 des Kommissionsberichts.
Natürlich haben auch die Ratsmitglieder hier noch eine gewisse Verantwortung wahrzunehmen, weil das Produkt auf ihren privaten Geräten als App oder über den Browser laufen wird.
Weil die Kommission nicht nur auf die positiven Erfahrungen der kantonalen und städtischen Stellen abstellen wollte, wurde für die dritte Sitzung noch ein Erfahrungsbericht eines Parlaments eingeholt, das schon länger mit dem Axioma Sitzungsmanagement arbeitet.
Konsultiert wurde das Stadtparlament St. Gallen. Dabei flossen auch die Erfahrungen der Stadtkanzlei resp. des Ratssekretariats sowie der Informatik mit dem Tool mit ein.
Die Einschätzungen der Vertreterinnen und Vertreter der Stadt St. Gallen waren durchwegs positiv.
Vor allem der zuverlässige und professionelle Support durch CMI sowie die Einfachheit der Bedienung für die Nutzerinnen und Nutzer wurde hervorgehoben.
Aufgrund der positiven Evaluation und der Empfehlungen der KSD für das Produkt Axioma Sitzungsmanagement kam die Kommission zum Schluss, Ihnen resp. dem Büro dessen Einführung zu beantragen.
Die KSD wird die Einführung begleiten. Dazu gehört die Parametrisierung auf unsere Bedürfnisse, aber auch die Schulung der Nutzerinnen und Nutzer.
Die KSD wird den Betrieb sicherstellen mitsamt Servicedesk für Anfragen und Hilfestellungen sowie der Wartung. Dazu gehört auch das Änderungsmanagement bei Releasewechseln und Updates.
Natürlich waren für den Antrag der Kommission auch die Kosten wichtig, die sehr bescheiden ausfallen, nicht zuletzt weil der Kanton bereits mit dem System arbeitet.
Die einmaligen Investitionskosten belaufen sich auf Fr. 25‘000. Hinzu kommen nochmals Fr. 25‘000 für die Implementierung und Parametrisierung. Diese Fr. 50‘000 sind bereits mit dem Budget 2022 genehmigt worden.
Die jährlich wiederkehrenden Aufwändungen betragen ca. Fr. 20’000. Sie setzen sich zusammen aus Fr. 12’000 für den Remote-Zugriff der Ratsmitglieder und ca. Fr. 8’000 für Supportleistungen der KSD.
Diesen Kosten stehen Einsparungen bei den Druck- und Portokosten für den Versand sowie zeitliche Entlastungen bei der KDMZ (Kantonale Druck- und Materialzentrale) und beim Ratssekretariat entgegen.
Erstere würden sich maximal auf ca. Fr. 20‘000 belaufen, wenn sich alle Ratsmitglieder vom papierbasierten Arbeiten verabschieden würden, letztere sind monetär nicht bezifferbar.
Wie schon in der Motion gefordert wurde, soll das neue System noch nicht verpflichtend sein. Wir sind jetzt eine «Umstellungsgeneration».
Ich bin aber überzeugt, dass die Bereitschaft zur Umstellung nicht nur eine Generationenfrage ist, sondern automatisch kommt, wenn die Ratsmitglieder, die noch stärker dem Papier verhaftet sind, bei ihren digitalaffineren Ratskolleginnen und -kollegen sehen, wie benutzerfreundlich das neue System ist und welche spürbaren Vorteile es bei der Ratsarbeit bringt.
Einig war man sich in der Kommission, dass die Jahresrechnung und das Budget vorderhand noch für alle auf Papier ausgefertigt werden.
Sie sehen, wir sind sehr pragmatisch unterwegs, so dass auch Skeptiker abgeholt werden können.
Der grosse Vorteil beim empfohlenen System ist, dass wir bei einem positiven Entscheid heute, die Einführung relativ schnell, d.h. noch bis Herbst/Winter 2022, bewerkstelligen können.
Die Parametrisierung auf die konkreten Anforderungen des Rates und des Ratssekretariats ist keine Hexerei und erste Schulungen könnten bereits im 4. Quartal stattfinden.
Die Schulung wird auch auf Video zur Verfügung stehen, damit auch später eintretende Ratsmitglieder davon profitieren können.
Und zum Schluss noch ein Vorteil: Wenn der Rat heute die Einführung des Sitzungsmanagement Axioma beschliesst, wird auch der Grosse Stadtrat die Einführung prüfen.
Eine parallele Einführung bei der Stadt hätte den Vorteil, dass Ratsmitglieder, die in beiden Räten sitzen, mit ein- und demselben System arbeiten können.
Fazit:
Wir beantragen Ihnen die Einführung von Axioma Sitzungsmanagement als Ratsinformationssystem zur Modernisierung und Erleichterung der Ratsarbeit, weil
- es sich um eine einfach zu bedienende, sichere Standardlösung handelt, welche in der ganzen Schweiz erfolgreich im Einsatz steht
- diese problemlos auf unsere Anforderungen und Bedürfnisse parametrisiert werden kann und durch ein führendes CH-Unternehmen stetig weiterentwickelt wird
- Regierung und Verwaltung bereits mit Axioma arbeiten, was die Schnittstellen und Durchlässigkeit zum Kantonsrat erleichtert
- das Ratssekretariat die Einführung befürwortet, weil es auch ihre Arbeit erleichtern wird
- die Kosten bescheiden sind
- die KSD, welche das System kennt, uns bei der Implementierung, der Schulung und beim Betrieb resp. der Wartung kompetent unterstützen wird
- wir damit einen wichtigen Schritt zur Digitalisierung und Modernisierung unseres Kantons machen können, zumal auch die Stadt und andere Gemeinden mit Parlamenten nachziehen werden.
Interview mit Tele Top vom 28.03.2022